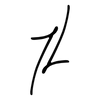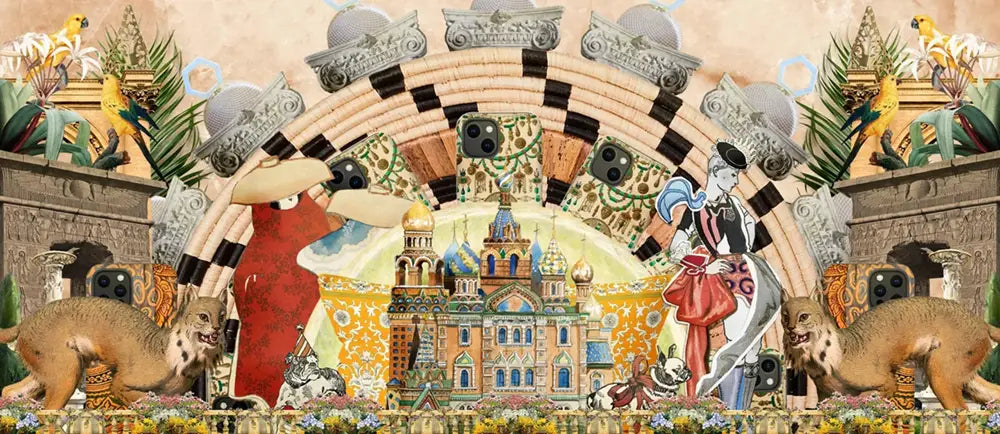Das Leben (und die Lieben) der queeren Könige und Königinnen durch die Geschichte
Stellen Sie sich einen Kaiser vor, der so seinem männlichen Geliebten ergeben ist, dass er lieber ein Gewand ruiniert, als den Schlaf seines Partners zu stören. Dies ist die berühmte Geschichte von Kaiser Ai von Han-China, der seinen Ärmel abschnitt, als sein Geliebter Dong Xian darauf einschlief – eine intime Geste, die das chinesische Sprichwort „die Leidenschaft des abgeschnittenen Ärmels“ hervorbrachte, das für immer die gleichgeschlechtliche Liebe symbolisiert. Solche Geschichten erinnern uns daran, dass LGBTQ+-Königtum keine moderne Erfindung ist, sondern ein Teil der globalen Geschichte, oft verborgen unter Schichten von Anstand und Politik.
Das Erbe der queeren Könige und Königinnen erstreckt sich über Kontinente und Jahrhunderte. Von antiken schwulen Königen und Königinnen, deren gleichgeschlechtliche Beziehungen als offene Geheimnisse aufgezeichnet wurden, mittelalterlichen Monarchen, die für ihre Favoriten Skandale riskierten, bis hin zu zeitgenössischen Royals, die ihre Wahrheit umarmen. Doch diese Erzählungen wurden lange Zeit verdeckt – durch historische Vorurteile, durch religiöse Zensur, durch koloniale Gesetze, die kulturelle Normen umschrieben.
Dieser Artikel erforscht das Leben dieser LGBTQ+ Monarchen, Aristokraten und Adligen, um zu enthüllen, wie sie lebten und liebten, wie ihre Identitäten wahrgenommen oder verfolgt wurden und wie ihre Geschichten im heutigen Kampf um Gleichberechtigung widerhallen. Eine fesselnde Entwicklung nachzeichnen, von der relativ offenen Haltung der Antike, durch dunkle Zeitalter der Unterdrückung, bis hin zum modernen Wiedererwachen des Stolzes in königlichen Höfen. Die Regenbogenfäden beleuchten, die ins Gewebe der königlichen Geschichte eingewoben sind.
Wichtige Erkenntnisse
- Entdecken Sie die reiche Geschichte und Beiträge von schwulen Königen und Königinnen zu kulturellen und politischen Landschaften.
- Erforschen Sie die oft übersehenen Geschichten von LGBTQ+ Monarchen, die mit sowohl Macht als auch Mitgefühl regierten.
- Erhalten Sie Einblick in die komplexen persönlichen Leben der queeren Adligen und wie sie königliche Pflichten und intime Beziehungen navigierten.
- Verstehen Sie die Komplexitäten, denen homosexuelle Könige und Königinnen in verschiedenen historischen und gesellschaftlichen Kontexten gegenüberstanden.
- Eintauchen in die Vermächtnisse von gleichgeschlechtlichen Herrschern, deren Einfluss über ihre Ära hinausreicht.
- Entdecken Sie die Widerstandsfähigkeit und unbestreitbare Präsenz von königlichen LGBTQ+ Figuren in den Annalen der Zeit.
- Reflektieren Sie über die breiteren Implikationen von schwulen Monarchien und LGBTQ Königtum in zeitgenössischen Diskussionen über LGBTQ+ Identität und Akzeptanz.
Alte Reiche und gleichgeschlechtliche Liebe: Offene Geheimnisse der Vergangenheit
In vielen antiken Gesellschaften wurden gleichgeschlechtliche Beziehungen an königlichen Höfen mit einem Grad an Akzeptanz getroffen, der spätere Generationen überraschen könnte. Begriffe wie „homosexuell“ oder „bisexuell“ existierten nicht – Herrscher wurden oft mehr nach ihrer Fähigkeit zu regieren beurteilt als nach dem Geschlecht ihrer Gefährten. In der klassischen Welt waren Ausdrucksformen männlicher Liebe, insbesondere unter der Elite, nicht ungewöhnlich.
 Alexander der Große und Hephaestion
Alexander der Große und Hephaestion
Der makedonische König Alexander der Große nahm nicht nur eine persische Frau in seiner Eroberung von Asien, sondern fand auch eine lebenslange Gefährtschaft mit seinem General Hephaestion. Während Historiker die genaue Natur von Alexanders Verbindung zu Hephaestion debattieren, erkennen sowohl antike Chroniken als auch moderne Gelehrte an, dass die beiden unzertrennlich waren und wahrscheinlich Liebhaber.
Alexanders öffentliche Trauer, als Hephaestion starb – die Beauftragung extravaganter Begräbnisehren – sprach lauter als jede Bezeichnung es je könnte. Wie ein Historiker bemerkte, “es gibt keine konkreten Beweise, dass Alexander und Hephaestion Liebhaber waren, aber viele Hinweise [deuten darauf hin], dass die beiden mehr als Freunde waren”.
In einem kulturellen Kontext, in dem bisexuelle Kaiser und Helden nicht ungewöhnlich waren, war Alexanders Intimität mit einem männlichen Gefährten emblematisch für die offene Sichtweise der Ära auf Sexualität (um eine Quelle zu zitieren) und für seine Zeitgenossen kaum skandalös. Es wurde verstanden, dass ein großer König sowohl die dynastische Pflicht erfüllen konnte, zu heiraten, als auch einen Mann als „den Liebling seines Lebens“ zu schätzen – ein Ausdruck, der von Alexanders Biografen verwendet wurde. So war die nuancierte Realität der queeren königlichen Geschichte in der Antike.
 Kaiser Ai von Han und Dong Xian
Kaiser Ai von Han und Dong Xian
Auf der anderen Seite der Welt in der Han-Dynastie Chinas finden wir ein noch offensichtlicheres Beispiel eines LGBTQ+ Monarchen, dessen gleichgeschlechtliche Liebe mit Bewunderung aufgezeichnet wurde. Kaiser Ai von Han (regierend 7–1 v. Chr.) umsorgte offen seinen männlichen Favoriten, Dong Xian, erhob ihn am Hof und zog dafür nur milde Missbilligung nach sich. Weit davon entfernt, ein Einzelfall zu sein, war Kaiser Ai Teil einer breiteren Tradition im frühen kaiserlichen China – einer Zeit, in der Bisexualität die Norm auf den höchsten Ebenen der Gesellschaft war.
Historiker bemerken, dass die Mehrheit der westlichen Han-Kaiser sowohl Ehefrauen als auch männliche Gefährten hatten. Kaisers Ais Liebe zu Dong Xian war so zärtlich, dass sie Poesie und eine Redewendung inspirierte: der erwähnte abgeschnittene Ärmel Die Geschichte wurde in offiziellen Geschichtsbüchern erzählt, und spätere Höflinge ahmten die Geste nach, indem sie ihre Ärmel abschnitten und die kaiserliche Romanze anerkannten.
„Diejenigen, die dem Herrscher dienten und es schafften, seine Ohren und Augen zu erfreuen... nicht nur [Frauen]... auch Höflinge und Eunuchen können dieses Spiel spielen,“ schrieb der Han-Historiker Sima Qian und bemerkte, wie männliche Favoriten sich in die Herzen der Kaiser schlichen. Die königliche gleichgeschlechtliche Romanze wurde in jener Zeit nicht versteckt oder verurteilt; sie war sachlich in das Hofleben eingebunden. Bis heute bewahrt die chinesische Sprache das Andenken an Kaiser Ai im Idiom für Homosexualität – ein Erbe der Akzeptanz, das später durch puritanischere Einflüsse erodiert wurde.
 Hadrian und Antinous
Hadrian und Antinous
Im Römischen Reich sehen wir ein ähnliches Muster: Während die römische Gesellschaft komplexe Regeln über Klasse und Status in der Liebe hatte, konnte ein Kaiser einen anderen Mann offen lieben, ohne seine Herrschaft zu gefährden. Kaiser Hadrian (2. Jahrhundert n. Chr.), bekannt für die Konsolidierung der Grenzen des Reiches, ist ebenso bekannt für seine tiefe Liebe zu Antinous, einem Jüngling von großer Schönheit.
Hadrian und Antinous reisten zusammen von der Hauptstadt in die Provinzen – bis die Tragödie in Ägypten zuschlug. Als Antinous 130 n. Chr. unter mysteriösen Umständen im Nil ertrank, war der Kaiser am Boden zerstört und trauerte öffentlich statt privat (eine ungewöhnliche Darstellung für einen römischen Mann). Was folgte, war vielleicht der extravaganteste Akt des Gedenkens an einen Gefährten in der römischen Geschichte.
Hadrian ließ Antinous vergöttlichen und im ganzen Reich verehren, gab unzählige Statuen seines Geliebten in Auftrag und gründete sogar eine völlig neue Stadt, Antinopolis, in der Nähe des Ortes seines Todes. Marmoreffigien des Gesichts des Jünglings – oft verschmolzen mit Göttern wie Osiris oder Dionysos – tauchten von Britannia bis Bithynia auf. Dieses kaiserliche Patronat machte Antinous effektiv zum ersten Bürgerlichen, der durch den Willen eines Kaisers ein Gott im römischen Pantheon wurde.
Die Liebesgeschichte von Hadrian und Antinous, buchstäblich in Stein gemeißelt, sandte durch die Jahrhunderte eine kraftvolle Botschaft: dass die Zuneigung eines römischen Herrschers zu einem anderen Mann ebenso monumental und unsterblich sein konnte wie seine Eroberungen. Es ist kaum verwunderlich, dass ihre Geschichte oft als eine der großen Romanzen der Geschichte zitiert wird – ein queeres königliches Erbe, das in Tempeln und Kunst statt in Texten bewahrt wird.
Nicht alle alten LGBTQ+-königlichen Erzählungen wurden so gefeiert wie Hadrian und Antinous, natürlich. Einige sind in der Übersetzung verloren gegangen oder absichtlich gedämpft worden. Wir wissen zum Beispiel von dem assyrischen König Assurbanipal, der Zuneigung zu einem männlichen Höfling in Keilschrift-Poesie festhielt, oder von Pharaonen Ägyptens, die gleichgeschlechtliche Rituale als Teil der göttlichen Königsherrschaft durchführten – aber viele solcher Berichte sind fragmentarisch. Eine Figur, deren Geschichte nur in skandalösen späteren Berichten überlebt hat, ist Kaiser Elagabalus von Rom (3. Jahrhundert n. Chr.), von dem gesagt wurde, er habe einen männlichen Sklaven geheiratet und sogar große Summen jedem Arzt angeboten, der ihn physisch in eine Frau verwandeln könnte – eine Beschreibung, die heute einige dazu veranlasst, Elagabalus als transgender oder geschlechtsnonkonforme königliche Person zu betrachten. Während römische Historiker (die Elagabalus aus vielen Gründen verachteten) diese Geschichten wahrscheinlich übertrieben haben, deuten sie darauf hin, dass Geschlechterfluidität im Palast kein modernes Phänomen ist. Tatsächlich haben Menschen, die die Geschlechterbinarität herausforderten oder flüssige Sexualität umarmten, unter Kronen und Tiaren existiert, lange bevor die heutige Terminologie entstand.
Aber sie waren doch nicht queer, oder?
Diese antiken Beispiele unterstreichen einen kritischen Punkt: Viele frühe Zivilisationen teilten Menschen nicht streng in „schwul“ oder „hetero“ ein, wie wir es heute tun. Sexuelle Fluidität unter Royals war oft ein offenes Geheimnis oder sogar ein erwartetes Privileg der Macht, besonders für Männer. Kaiser und Könige nahmen Liebhaber beider Geschlechter, ohne dass die Welt stehen blieb – oder die Geschichte sie direkt verurteilte. Das moderne Konzept der „Homosexualität“ als Identität entstand erst im 19. Jahrhundert; davor zählte Verhalten mehr als Etiketten.
Wenn wir über LGBTQ+-Monarchen in der Antike sprechen, müssen wir vorsichtig sein: Diese Herrscher sahen sich wahrscheinlich nicht als „queer“ im modernen Sinne, aber ihr Leben zeigt ein Spektrum von Wünschen und Beziehungen, die wir heute als Teil der queeren Geschichte erkennen. Entscheidend ist, dass ihre Geschichten auch zeigen, wie überraschend tolerant die Einstellungen sein konnten. Antike Chroniken feierten Liebe und Loyalität – ob zwischen Mann und Frau oder Mann und Mann – solange sie die Dynastie nicht bedrohten. Aber diese relative Offenheit würde nicht von Dauer sein, da neue Religionen und politische Strukturen später strengere Urteile über gleichgeschlechtliche Liebe in königlichen Familien verhängten.
Mittelalterliche und Renaissance-Realitäten: Verbotene Liebe, Skandal und Überleben
Mit dem Aufstieg des Christentums und anderer organisierter Religionen wich die in der Antike gesehene Freizügigkeit strengeren moralischen Kodizes – zumindest auf dem Papier. Im mittelalterlichen Europa war Sodomie offiziell eine Sünde, und Chroniken wurden zurückhaltender über königliche Favoriten desselben Geschlechts. Doch selbst in einem Zeitalter strenger Orthodoxie traten queere Beziehungen hinter den Schlossmauern auf , manchmal die Politik auf tiefgreifende Weise beeinflusst. Weit davon entfernt, eine einheitlich heteronormative Zeit zu sein, bieten die Mittelalter mehrere bemerkenswerte Beispiele von LGBTQ+ Adligen, die Liebe und Macht oft im Verborgenen navigierten.
 König Edward II. von England und Piers Gaveston
König Edward II. von England und Piers Gaveston
Eines der frühesten und berüchtigtsten Beispiele ist König Edward II. von England (1284–1327). Edwards Herrschaft war turbulent – geprägt von militärischen Misserfolgen und baronialen Revolten – und ein Großteil dieser Unruhen drehte sich um seine intensiven Beziehungen zu zwei Männern: Piers Gaveston und später Hugh Despenser der Jüngere. Gaveston war Edwards engster Begleiter seit der Jugend, ein charismatischer Ritter, den der König zum Earl of Cornwall erhob. Ihre Bindung war so stark, dass sie sofortige Eifersucht und Alarm unter dem Rest des Adels hervorrief.
Mittelalterliche Chronisten vermieden es, Edward und Gaveston ausdrücklich als Liebhaber zu bezeichnen, aber sie kommentierten die außergewöhnliche Nähe zwischen ihnen und die Vernachlässigung der Königin durch den König zugunsten von Gaveston. Ein zeitgenössischer Bericht beschrieb ihr erstes Treffen als inspirierend ein „unzerbrechliches Band der Liebe“ – der junge Prinz Edward soll beim Anblick von Gaveston „einen Bruderbund mit ihm geschlossen haben… vor allen Sterblichen, in einem unzerbrechlichen Band der Liebe“. Solche Sprache, auch wenn sie als „Bruderschaft“ formuliert ist, war außergewöhnlich und deutet auf eine tiefe Zuneigung jenseits bloßer Freundschaft hin.
Moderne Historiker sind sich im Allgemeinen einig, dass Edwards II. Beziehung zu Gaveston romantisch und wahrscheinlich sexuell war. Der König nannte Gaveston berühmterweise „mein Bruder“ und „mein süßer Gaveston“, laut Chronisten, und als er gefragt wurde, warum er diesen Mann so begünstigte, antwortete Edward: „Weil er mich mehr liebt als die ganze Welt“. Dies sind kaum die Worte einer einfachen Kameradschaft – sie sprechen von einer echten Liebe im königlichen Schlafgemach.
Die politischen Folgen war schwerwiegend: Barone verbannten und ermordeten schließlich Gaveston im Jahr 1312, da sie ihn als Emporkömmling betrachteten, der den König verzaubert hatte. Edwards Trauer war immens, aber er „lernt seine Lektion nicht“ – einige Jahre später schenkte er Hugh Despenser ähnliche Zuneigung und Macht. Auch diese Beziehung wurde weithin als sexuell gemunkelt (Königin Isabella, Edwards Frau, dachte das sicherlich und begann, Hugh zu verabscheuen). Sie trug zu einem Aufstand der Barone und Isabellas eigener Rebellion an der Seite ihres Liebhabers Roger Mortimer bei.
Im Jahr 1327 wurde Edward II. gestürzt und wahrscheinlich in Gefangenschaft getötet, was ihn zum ersten englischen Monarchen machte, der von seinen Untertanen abgesetzt wurde. Während viele Faktoren zu Edwards Sturz führten, war die Wahrnehmung, dass er seinen männlichen Favoriten unnatürlich ergeben war – ein König, der von seinen Liebhabern regiert wurde – zentral. Eine Analyse von English Heritage kommt zu dem klaren Schluss, dass „der Sturz des Königs teilweise auf seine Abhängigkeit von seinen ‘Favoriten’, Piers Gaveston und Hugh Despenser, die angeblich seine Liebhaber waren, zurückzuführen war“.
In einer Ära, in der die Monarchie sakrosankt war, nährte der Skandal um einen homosexuellen König, der seine Pflichten nicht erfüllte, eine von seinen Feinden vorangetriebene Erzählung, dass seine Herrschaft weibisch und ungehörig war. Die tragische Geschichte von Edward II. zeigt, wie Homophobie (auch wenn der Begriff noch nicht existierte) mit der Politik verflochten war – seine Barone nutzten seine queere Zuneigung als Waffe, um Rebellion zu rechtfertigen, und spätere Schriftsteller machten ihn zu einer warnenden Geschichte.
 Kalif Al-Hakam II. von Córdoba
Kalif Al-Hakam II. von Córdoba
Doch das mittelalterliche Europa war nicht einheitlich feindlich gegenüber gleichgeschlechtlicher Liebe. In einigen Höfen herrschte eine pragmatische Haltung des Nicht-Fragens und Nicht-Erzählens. Betrachten Sie den Fall von Philipp dem Schönen von Frankreich und Prinz Li Shimin. Oder blicken Sie nach Süden zum iberischen Kalifat von Córdoba im 10. Jahrhundert.
Unter islamischer Herrschaft hatte Al-Andalus (muslimisches Spanien) seinen eigenen berühmten schwulen König: Kalif Al-Hakam II (915–976) von Córdoba. Al-Hakam II war ein Förderer der Künste und Wissenschaften, dem der Bau der großen Bibliothek von Córdoba und die Erweiterung der berühmten Moschee zugeschrieben werden. Er soll laut zeitgenössischen Gerüchten und modernen Historikern die Gesellschaft von Männern der von Frauen vorgezogen haben.
Es wurde gesagt, dass Al-Hakam einen männlichen Harem oder ghulam von attraktiven jungen Männern hielt. Seine eine bemerkenswerte Frau, eine Konkubine, die zur Königin wurde, namens Subh (auch bekannt als Aurora), soll sich als junger Mann verkleidet haben, um die Aufmerksamkeit des Kalifen zu erregen, indem sie einen kurzen Haarschnitt und Jungenkleidung annahm, damit Al-Hakam sie ansprechend finden könnte.
Quellen aus späteren Perioden sprechen verschämt von Al-Hakams ḥubb al-walad – Liebe zu Jungen – um zu beschreiben, warum er die Produktion eines Erben verzögerte. Einige Gelehrte interpretieren diesen Ausdruck als Beweis für seine Homosexualität. Obwohl er schließlich mit Subh einen Sohn zeugte, ist es bezeichnend, dass Subh die Rolle eines männlichen Jugendlichen namens „Ja’far“ spielen musste, um seine Zuneigung zu gewinnen.
Innerhalb des Hofes schien Al-Hakams Orientierung toleriert zu werden (wenn auch darüber getratscht wurde); seine Herrschaft war wohlhabend und intellektuell, und er sah sich keinen Aufständen aufgrund seines Privatlebens gegenüber. Doch spätere Chronisten unter christlicher Herrschaft oder konservative muslimische Gelehrte würden seine Sexualität herunterspielen oder euphemisieren – ein subtiler früher Fall von Queer-Löschung, als sich die moralischen Strömungen änderten. Dennoch überlebte die Erinnerung: Al-Hakam II wird heute nicht nur für seine Bibliothek in Erinnerung behalten, sondern auch als Beispiel dafür, dass mittelalterliche islamische Reiche, ähnlich wie das Christentum, ihren Anteil an queerer Adeligkeit hatten.
 König Heinrich III. von Frankreich
König Heinrich III. von Frankreich
Schnell vorwärts zur Renaissance und frühen Neuzeit, und man stellt fest, dass die Höfe noch mehr von Intrigen über die Sexualität der Herrscher und ihrer Favoriten durchzogen waren. Ein auffälliger Fall ist König Heinrich III. von Frankreich (1551–1589), der letzte der Valois-Linie. Heinrich III. umgab sich mit einer Schar exquisiter männlicher Favoriten, die “les mignons” – wörtlich „die Lieblinge“ – genannt wurden. Diese gutaussehenden jungen Höflinge kleideten sich in den neuesten modischen, oft aufwendigen, sogar femininen Gewändern und genossen offen die Zuneigung des Königs.
In einem von den Religionskriegen zerrissenen Frankreich wurde Henrys effeminierter Stil und sein enger Kreis männlicher Favoriten zu einer politischen Waffe für seine Kritiker. Verleumderische Pamphlete stellten den König als ausschweifend dar und seine Mignons als sexuelle Abweichler. Während Historiker warnen, dass nicht alle solche Behauptungen vertrauenswürdig sind (viele waren Propaganda von Feinden, insbesondere der ultrakatholischen Liga), war die Wahrnehmung von Heinrich III. als „sodomitisch“ und „effeminiert“ weit verbreitet.
Öffentliche Klatschgeschichten schrieben den Mignons und somit dem König „heterodoxe Sexualität“ zu. Einige moderne Wissenschaftler glauben tatsächlich, dass Heinrich III. überwiegend homosexuell oder bisexuell war und führen seine Kinderlosigkeit und die außergewöhnliche Bevorzugung dieser Männer an. Ungeachtet dessen wurden die Gerüchte selbst zu einem Faktor für seinen Untergang: Sie untergruben den Respekt für die Monarchie und wurden als „Faktor für den Zerfall der späten Valois-Monarchie“ angesehen.
Im Jahr 1589 wurde Heinrich von einem religiösen Fanatiker ermordet – der die Tat bezeichnenderweise teilweise damit rechtfertigte, den König der Unmoral zu beschuldigen. Somit veranschaulicht Heinrichs III. Herrschaft, wie öffentliche Böswilligkeit gegenüber einem möglicherweise schwulen Monarchen in größere politische Krisen einfließen konnte. In seinem Fall halfen queer-bezogene Verleumdungen, einen König in Zeiten des Bürgerkriegs zu delegitimieren, was zeigt, dass im 16. Jahrhundert die wahrgenommene LGBTQ+-Identität eines Herrschers tatsächlich gegen ihn eingesetzt werden konnte.
 König James VI. von Schottland und I. von England
König James VI. von Schottland und I. von England
Zur gleichen Zeit navigierte ein anderer König in den benachbarten Ländern England und Schottland die Komplexitäten von Liebe und Macht. König James VI. von Schottland und I. von England (1566–1625) – der Monarch, der die King-James-Bibel sponserte – wird heute von den meisten Wissenschaftlern als bisexueller oder schwuler Mann anerkannt, obwohl er ein verheirateter Vater von acht Kindern war.
Seit seiner Jugend zeigte James eine ausgeprägte Vorliebe für männliche Gesellschaft. Er förderte eine Reihe von männlichen Favoriten – darunter Esmé Stewart (Lord d’Aubigny), Robert Carr (Earl of Somerset) und am bekanntesten George Villiers, den Herzog von Buckingham – zu außergewöhnlichen Höhen und überschüttete sie mit Titeln und Zuneigung.
Zeitgenössische Höflinge machten sich lustig und schrieben Verse über die „Favoriten“ des Königs, und ausländische Beobachter berichteten über das ungewöhnlich intime Verhalten, das James zeigte (wie das Küssen von Villiers in der Öffentlichkeit und das Ansprechen mit Kosenamen).
James selbst tat wenig, um seine Gefühle zu verbergen; zahlreiche erhaltene Briefe von König James an Buckingham sind leidenschaftlich liebevoll. In einem schreibt James, “Ich würde lieber verbannt in irgendeinem Teil der Erde mit dir leben, als ein trauriges Witwenleben ohne dich zu führen”, und in einem anderen unterzeichnet er als “Dein lieber Papa und Ehemann, James”. Solche Mitteilungen als etwas anderes als Ausdrücke romantischer Liebe zu lesen, fällt schwer. Tatsächlich liefert eine große Sammlung dieser Briefe “den klarsten Beweis für James’ homoerotische Wünsche”.
Moderne Historiker sind sich weitgehend einig, dass James' Beziehungen zu zumindest einigen dieser Favoriten “eindeutig sexuell waren,” angesichts der Beweislage. Bemerkenswerterweise war James auch ein gelehrter König, der Essays gegen Sodomie schrieb (vielleicht eher aus öffentlicher Pflicht als aus persönlicher Überzeugung), und er sicherte die königliche Linie, indem er seine ehelichen Pflichten gegenüber Königin Anne von Dänemark erfüllte. Aber sein Herz, so scheint es, gehörte woanders hin.
Entscheidend ist, dass James I. keine Revolte im Stil von Gaveston erlebte; zu seiner Zeit hatte sich der englische Hof widerwillig an die Vorstellung eines Königs mit männlichen Liebhabern angepasst, solange diese Männer ihre Stellung nicht grob missbrauchten. Buckingham jedoch erlangte große Macht und war zutiefst unbeliebt – das Parlament versuchte sogar, ihn anzuklagen – doch James schützte ihn bis zum Ende. “Der König selbst, wage ich zu sagen, wird als Sodomit leben und sterben,” schrieb ein spitzzüngiger Abgeordneter im Jahr 1617, wobei er den harten Begriff der damaligen Zeit verwendete.
Nach James' Tod blieb Buckingham unter Charles I. einflussreich, was zeigt, dass das System der königlichen Favoriten im Wesentlichen zu einer akzeptierten (wenn auch verachteten) Institution geworden war. Im Fall von James waren seine queeren Beziehungen ein offenes Geheimnis, das Klatsch und Spannungen auslöste, aber letztendlich innerhalb der Dynamik der Hofpolitik gehalten wurde. Seine Herrschaft legt nahe, dass im 17. Jahrhundert ein Monarch offen liebevoll zu einem gleichgeschlechtlichen Favoriten sein und dennoch seinen Thron behalten konnte – ein heikler Balanceakt aus persönlicher Neigung und politischem Geschick. Es unterstreicht auch, wie moderne Identitätskonzepte nicht einfach anwendbar sind.
James identifizierte sich wahrscheinlich nicht als “schwul” (er hätte sich als voll und ganz von Gott gesalbter König betrachtet, dessen private Liebe zufällig auf Männer gerichtet war). Dennoch bildet seine Geschichte ein wichtiges Kapitel der europäischen LGBTQ+-Königsgeschichte, das sowohl das Stigma als auch die Nachsicht zeigt, denen queere Monarchen ausgesetzt waren. Die Gesellschaft tuschelte und kicherte, tolerierte jedoch weitgehend James' Verhalten, denn er war schließlich der König.
 Königin Anne und Sarah Churchill
Königin Anne und Sarah Churchill
Es waren nicht nur Könige. Königinnen und weiblicher Adel im Mittelalter und in der frühen Neuzeit waren ebenfalls in gleichgeschlechtliche Beziehungen verwickelt, obwohl ihre Geschichten oft noch mehr verschleiert sind. Ein Beispiel dafür ist Königin Anne von Großbritannien (1665–1714). Anne war bekannt für außerordentlich enge, emotional intensive Beziehungen zu Frauen an ihrem Hof – insbesondere zu Sarah Churchill, Herzogin von Marlborough. Die beiden Frauen waren seit Annes Jugend unzertrennlich und nannten sich gegenseitig Kosenamen („Mrs. Morley“ und „Mrs. Freeman“) und korrespondierten ständig.
Sarah übte während eines Großteils von Annes Herrschaft erheblichen politischen Einfluss aus, was einige Historiker als nahezu eheähnliche Rolle beschreiben. Ihr Zerwürfnis – und Annes anschließende Zuneigung zu einer neuen Favoritin, Abigail Masham – hat all das Drama eines Liebesdreiecks, und tatsächlich wurde es in dem kürzlich mit einem Oscar ausgezeichneten Film The Favourite als solches dargestellt.
Waren Anne und Sarah tatsächlich Liebhaberinnen im physischen Sinne? Das historische Urteil steht noch aus. Einige ihrer Briefe verwenden Koseworte, die platonisch oder romantisch gelesen werden könnten. Unbestreitbar ist die Leidenschaft und Eifersucht, die ihre Beziehung prägte, die „für [ihre] enge Beziehung und berichtete Romanze“ bekannt war in den Augen der Zeitgenossen.
Sarahs eigene Memoiren, die später geschrieben wurden, spielen jeden unangebrachten Aspekt herunter und führen alles auf Freundschaft zurück. Dennoch kann man nicht ignorieren, dass Sarah, als sie abrupt entlassen wurde, versuchte, die Königin zu erpressen, indem sie drohte, Annes private Briefe zu veröffentlichen – was implizierte, dass sie kompromittierende Zuneigung enthielten.
Königin Annes Ruf in der Öffentlichkeit blieb intakt (sie wurde als hingebungsvolle Ehefrau von Prinz George von Dänemark angesehen, obwohl sie keine überlebenden Kinder hatten), aber innerhalb des Hofes kursierten sicherlich Gerüchte. Einige spekulierten sogar, dass Annes Trauer um Georges Tod weniger heftig war als ihre Verzweiflung über den Verlust von Sarahs Gesellschaft.
Annes Leben spiegelt das vieler aristokratischer Frauen ihrer Zeit wider: eingeschränkt durch Erwartungen, zu heiraten und Erben zu gebären, aber echte emotionale Erfüllung in tiefen weiblichen Freundschaften zu finden – was spätere Generationen als „romantische Freundschaften“ oder sogar verdeckte lesbische Beziehungen bezeichnen könnten. Der Fall von Prinzessin Isabella von Bourbon-Parma im 18. Jahrhundert ist ein weiteres eindrucksvolles Beispiel: Unglücklich mit Joseph II. von Österreich verheiratet, goss Isabella stattdessen ihr Herz in über 200 Briefe an ihre Schwägerin, Erzherzogin Maria Christina. „Ich beginne den Tag damit, an das Objekt meiner Liebe zu denken... Ich denke unaufhörlich an sie“, schrieb Isabella an Maria Christina. Die beiden verbrachten ihre gesamte Zeit zusammen am Hof, und Isabella gestand, dass diese Beziehung „die große Liebe ihres Lebens“ war, auch wenn sie ihr wegen ihrer unmöglichen Natur Kummer bereitete.
Sie starb jung, und ihre Briefe (die überlebt haben) lassen kaum Zweifel daran, dass dies zumindest von Isabellas Seite aus eine tiefgründige lesbische Romanze an einem der mächtigsten Höfe Europas war. Solche Geschichten erinnern uns daran, dass lesbische und bisexuelle Frauen im Königshaus ihre eigenen verborgenen Geschichten haben, die damals oft aufgrund gesellschaftlicher Zwänge als intensive Freundschaft interpretiert wurden, aber im Nachhinein eindeutig Teil der LGBTQ+-Königshaus-Erzählung sind.
 Philippe I., Herzog von Orléans
Philippe I., Herzog von Orléans
Die Renaissance- und Aufklärungszeit brachte auch eine interessante Kategorie von LGBTQ+-Aristokraten hervor, die keine Monarchen waren, aber der Macht nahe standen. Eine berühmte Figur ist Philippe I., Herzog von Orléans (1640–1701), der jüngere Bruder von Frankreichs Ludwig XIV. Philippe d’Orléans war offen homosexuell und trug oft Frauenkleidung am prunkvollen französischen Hof. Er hatte eine langjährige männliche Geliebte, den Chevalier de Lorraine, unter anderen.
Bemerkenswert ist, dass Ludwig XIV. – der ultimative absolutistische König – die auffällige Homosexualität seines Bruders mit wenig Problemen tolerierte. Tatsächlich war der französische Hof des 17. Jahrhunderts „verhältnismäßig tolerant im Vergleich zu anderen Ländern“, wenn es um Philippes Verhalten ging.
Ludwig XIV.s Haltung war pragmatisch: Da Philippe nicht in der Thronfolge stand (sobald Ludwig Erben hatte), waren seine Angelegenheiten größtenteils seine eigene Sache. Ludwig bestand darauf, dass Philippe heiratete (zweimal, um legitime Nachkommen zu zeugen und Allianzen zu sichern), also heiratete Philippe pflichtbewusst Frauen und zeugte Kinder. Aber jeder in Versailles wusste, wo seine wahren Interessen lagen.
Das öffentliche Spektakel von Philippe, der in Kleidern und Diamanten paradierte und ohne Ironie „Monsieur“ (der traditionelle Titel für den Bruder des Königs) genannt wurde, zeigt, dass es selbst unter wachsendem religiösem Konservatismus Taschen von queerer Akzeptanz in der Aristokratie gab.
Es half, dass Philippes Rolle politisch bequem war – sein offenes Desinteresse am Wettstreit um den Thron machte ihn nicht bedrohlich, und einige Historiker vermuten, dass Ludwig XIV. sogar Vorteile darin sah, einen Bruder zu haben, der von gutaussehenden Männern „abgelenkt“ war, anstatt nach Macht zu streben. Die Franzosen prägten den Begriff „Italienische Vorlieben“, um diskret auf Philippes Orientierung hinzuweisen (wobei auf damalige Gerüchte über weit verbreitete Homosexualität in Italien angespielt wurde), und größtenteils wurde er geduldet.
Die Saga des Herzogs von Orléans zeigt, dass die Akzeptanz von LGBTQ+-Royals oft vom sozialen Kontext abhing: Ein mächtiger König konnte ein schwules Geschwisterkind vor Zensur schützen, während ein schwuler König möglicherweise einer viel strengeren Prüfung ausgesetzt wäre. Dennoch sticht Philippe d'Orléans in den Annalen der europäischen Höfe als einer der wenigen Royals in der Geschichte heraus, die ziemlich offen als schwuler Mann lebten und dennoch eine gefeierte Figur blieben (er war einmal ein Kriegsheld und führte Truppen in die Schlacht – das Tragen weiblicher Kleidung hinderte ihn nicht daran, tapfer zu kämpfen).
Geschlechtsrebellen in königlichem Gewand: Frauen, die König sein wollten, Männer, die Königin sein wollten
Jenseits der sexuellen Orientierung gibt es in der königlichen Geschichte auch leuchtende Beispiele für Geschlechtsnonkonformität – Könige und Königinnen, die die starren Geschlechterrollen ihrer Zeit missachteten. In Zeiten, in denen das Konzept, transgender oder nicht-binär zu sein, nicht formell definiert war, stellten diese Figuren dennoch binäre Erwartungen in Frage und lebten auf eine Weise, die moderne Beobachter oft als frühe Ausdrücke von trans- oder genderfluiden Identitäten interpretieren. Zwei außergewöhnliche Königinnen des 17. Jahrhunderts – eine aus Afrika und eine aus Europa – zeigen, wie königliche Macht manchmal Schutz bot, um Geschlechternormen zu trotzen, und wie diese trotzigen Leben von der Nachwelt aufgezeichnet (oder verzerrt) wurden.
 Königin Nzinga
Königin Nzinga
Im Königreich Ndongo und Matamba in Zentralafrika (dem heutigen Angola), Königin Nzinga (Ana Nzinga) hebt sich als eine entschlossene Herrscherin hervor, die absichtlich die Geschlechtergrenzen verwischte. Nzinga (circa 1583–1663) erbte den Thron in einer Krisenzeit – die Portugiesen drangen ein, der Sklavenhandel verwüstete ihr Volk, und weibliche Herrscherinnen waren in ihrer patriarchalischen Gesellschaft ungewöhnlich.
Um unter männlichen Rivalen Autorität zu behaupten, nahm Nzinga in vielen Aspekten der Regierungsführung eine männliche Persona an. Sie kleidete sich bei Audienzen in Männerkleidung, bestand darauf, als „König“ statt „Königin“ bezeichnet zu werden, und hielt sogar einen Harem junger Männer, die sie Berichten zufolge als ihre „Ehefrauen“ bezeichnete und so das traditionelle Geschlechterskript umkehrte.
Einige Berichte (wenn auch von späteren oder voreingenommenen Quellen) behaupten, dass diese männlichen Konkubinen gezwungen wurden, sich als Frauen zu kleiden. Nzinga’s mutige Darstellung von Männlichkeit war nicht nur persönlich; es war strategisch und nutzte indigene Überzeugungen, dass das Geschlecht für Personen mit außergewöhnlichem Status fließend sein konnte.
In der Ndongo-Kultur, wie in mehreren anderen vorkolonialen afrikanischen Gesellschaften, konnte Macht das Geschlecht übersteigen – Frauen konnten in bestimmten Kontexten „weibliche Ehemänner“ werden und Ehefrauen nehmen. Nzinga’s Leben verkörperte diese Fluidität. Indem sie Truppen in Kampfmontur kommandierte und Verträge als Gleichberechtigte mit männlichen Gouverneuren aushandelte, sendete sie eine klare Botschaft, dass Führung, nicht das Geschlecht, sie definierte.
Identifizierte sich Nzinga privat als Mann, oder war ihr Geschlechterwechsel rein politisches Theater? Wir können ihre inneren Gefühle nicht wissen. Klar ist, dass sie sich weigerte, sich den Erwartungen an weibliches Verhalten zu unterwerfen.
Ein Historiker stellt fest, dass Nzinga’s Fähigkeit, eine „queere Identität zu performen“ (um einen modernen Ausdruck zu verwenden), teilweise darauf zurückzuführen ist, dass ihr königlicher Status ihr Spielraum gewährte. Das mindert nicht die Realität, dass Nzinga wahrscheinlich Aspekte ihrer Weiblichkeit unterdrücken musste, um ernst genommen zu werden. Ihre Geschichte überlebte in portugiesischen Aufzeichnungen (die sie oft als „männliche“ Barbarin dämonisierten) und in der mündlichen Überlieferung (die sie als Befreierin lobte, die die Europäer überlistete).
Heute wird Königin Nzinga als Ikone des Widerstands gefeiert und oft in LGBTQ+-Geschichtsdiskussionen als mögliches Beispiel einer frühen geschlechtsnonkonformen Führerin zitiert. Unabhängig davon, ob wir sie mit einem modernen Begriff bezeichnen würden, zeigt Nzinga’s bewusste Subversion von Geschlechterrollen, dass queere Ausdrucksformen von Geschlecht tiefe historische Wurzeln in königlichen Abstammungslinien haben.
 Königin Christina von Schweden
Königin Christina von Schweden
Etwa zur gleichen Zeit in Europa, Königin Christina von Schweden (1626–1689) machte aufgrund ihrer eigenen Geschlechter- und sexuellen Ambiguität von sich reden. Christina bestieg als Teenager den schwedischen Thron und erlangte schnell Berühmtheit für ihr unkonventionelles Verhalten. Sie trug wann immer sie wollte männliche Kleidung, verzichtete auf die aufwendigen Kleider, die von weiblichen Royals erwartet wurden, und war akademisch brillant in einer Zeit, in der die Bildung von Frauen selten war. Christina weigerte sich auch zu heiraten, eine nahezu undenkbare Entscheidung für eine regierende Königin (da Ehen Werkzeuge der Allianz waren und Erben eine dynastische Notwendigkeit).
Gerüchte über ihre Sexualität kursierten. Sie entwickelte eine enge Bindung zu ihrer Hofdame, Gräfin Ebba Sparre, die sie als ihre „Bettgenossin“ bezeichnete und mit der sie eine enge Kameradschaft pflegte, die viele als romantisch spekulierten. Briefe deuten auf eine tiefe Zuneigung hin, und Höflinge bemerkten sicherlich, wie unzertrennlich sie waren. Während Historiker darüber debattieren, ob Christinas und Ebbas Beziehung physisch-sexuell war, war sie zweifellos die wichtigste emotionale Bindung im Leben der Königin.
Unterdessen erfreute sich Christina an als männlich geltenden Beschäftigungen: Sie war eine ausgezeichnete Reiterin, eine Förderin von männlich dominierten Bereichen wie Philosophie und Theater und sprach sogar in quasi-männlichen Begriffen von sich selbst. Schließlich schockierte Christina 1654 Europa, indem sie ihren Thron abdankte, Männerkleidung anzog und nach Rom zog, wo sie zum Katholizismus konvertierte.
In Rom setzte Christina ihre Missachtung der Geschlechternormen fort – sie wurde einmal in Rüstung wie ein männlicher Ritter gemalt. Ein Brief des Vatikans bemerkte sogar ihr „ambivalentes Geschlecht“ und stellte fest, dass sie kaum in die Rolle eines Königs oder einer Königin passte.
Christinas Leben wurde später romantisiert und sogar skandalisiert – einige Pamphlete behaupteten Affären mit sowohl Männern als auch Frauen. Moderne Kommentatoren haben Christina unterschiedlich als Pionierfeministin, lesbische Ikone oder möglicherweise als transgeschlechtliche Figur interpretiert, angesichts ihres geäußerten Unbehagens mit Weiblichkeit.
Unbestreitbar ist, dass Königin Christina nach ihren eigenen Bedingungen lebte und bei jeder Gelegenheit die Regeln der Geschlechterdarstellung brach. Ihr Zeitgenosse, der Philosoph Descartes (den sie nach Schweden einlud), könnte sie als lebendiges Beispiel für Geist über Materie gesehen haben – sie weigerte sich, ihren weiblichen Körper bestimmen zu lassen, was ihr Geist und Wille tun konnten.
Christinas Geschichte, ähnlich wie die von Nzinga, unterstreicht, dass LGBTQ+-Royals nicht nur durch die definiert wurden, die sie liebten, sondern auch durch die Art, wie sie ihr Geschlecht identifizierten und ausdrückten. Ihre Selbstdarstellung war eine Form der Rebellion gegen gesellschaftliche Normen, Jahrhunderte bevor Begriffe wie „genderqueer“ oder „nicht-binär“ existierten. Diese „Geschlechterrebellen“ erweitern unser Verständnis von queerer Adeligkeit: Es geht nicht nur um Könige mit Freunden oder Königinnen mit Freundinnen, sondern auch um diejenigen, die Geschlechterkategorien überschritten. innerhalb königlicher Rahmenwerke
Es ist bemerkenswert, dass solche Figuren oft in Zeiten des Umbruchs oder Übergangs erscheinen – Nzinga während der Kolonialisierung, Christina während der Umbrüche der Reformationszeit – als ob Krisen Raum für das Unkonventionelle schaffen. Sie heben auch hervor, wie spätere Erzählungen durch Vorurteile geprägt werden können: Koloniale und religiöse Schriftsteller versuchten, Nzinga's und Christinas queere Aspekte zu löschen oder zu verteufeln, indem sie sie entweder als exzentrische Fußnoten oder als verdorben darstellten.
Erzherzog Ludwig Viktor von Österreich
Bis zum achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert tauchten mehr solcher Beispiele auf: Adelige wie Erzherzog Ludwig Viktor von Österreich im 19. Jahrhundert lebten innerhalb ihrer sozialen Sphäre als „offen schwul“, auch wenn die öffentlichen Medien der Zeit in Euphemismen sprachen. Ludwig Viktor („Luziwuzi“, wie er genannt wurde) war der jüngere Bruder von Kaiser Franz Joseph und machte wenig Versuch, seine Homosexualität zu verbergen.
Jahrelang war es ein offenes Geheimnis, das unter strenger Pressezensur, die es aus den Zeitungen fernhielt, stillschweigend toleriert wurde. Er veranstaltete Partys, förderte die Künste und lehnte alle Versuche seiner Familie, ihn mit einer Prinzessin zu verheiraten, entschieden ab.
Schließlich ging Ludwig Viktors Glück zu Ende: Er machte dem falschen Mann im Wiener Zentralbadhaus Avancen (Berichten zufolge ein Offizier), der daraufhin den Erzherzog schlug. Der daraus resultierende Skandal im Badhaus – unmöglich vollständig unter den Teppich zu kehren – veranlasste Kaiser Franz Joseph, seinen Bruder 1861 aufs Land zu verbannen.
Ludwig Viktor verbrachte seine Tage in stiller Verbannung auf Schloss Klessheim in Salzburg, sein öffentliches Leben war im Wesentlichen vorbei, sobald sein queerer Ausflug zu öffentlich wurde. Bemerkenswerterweise wurde selbst dann die offizielle Begründung verschwiegen und als „Gesundheits-“ oder „Charakter-“ Probleme dargestellt; zuzugeben, dass ein Mitglied der Habsburger Familie wegen homosexuellen Verhaltens verbannt wurde, war in der offiziellen Erzählung undenkbar. Dennoch machen die Tagebücher und Briefe jener Zeit deutlich, warum „Luziwuzi“ weggeschickt wurde.
Diese Episode zeigt, dass bis zum 19. Jahrhundert die Toleranz der europäischen Aristokratie ihre Grenzen hatte: Ein schwuler Prinz konnte nur er selbst sein, solange Diskretion herrschte. Ein öffentlicher Skandal, der Homosexualität beinhaltete, konnte nicht ertragen werden. Es ist ein Muster, das sich in verschiedenen Formen bis vor kurzem wiederholen würde – ein Doppelleben zu führen war oft der Preis, den queere Adelige zahlen mussten, um in der Gesellschaft zu überleben.
Entscheidend ist, dass diese Beziehungen, auch wenn das Stigma zunahm, nicht verschwanden – sie gingen einfach in den Untergrund oder wurden in einer feinen Sprache verhüllt. Das menschliche Herz, selbst eines, das von einer Krone beschwert ist, würde sich nicht so leicht gesetzlich regeln lassen. Die Bühne war nun bereitet für eine Kollision zwischen langjährigen queeren königlichen Traditionen und den bevorstehenden Kräften des Imperialismus und der viktorianischen Moral, die einen der größten Versuche der Geschichte unternehmen würden, die Akzeptanz von LGBTQ+ auszulöschen.
Erst in den letzten Jahrzehnten haben Forscher diese LGBTQ+ königlichen Geschichten "wiederentdeckt", indem sie sie in einem verständnisvolleren Licht interpretierten. Projekte zur Neuuntersuchung historischer Aufzeichnungen haben gezeigt, dass viele Kulturen vor dem 19. Jahrhundert auf den höchsten Ebenen mehr Geschlechterfluidität zuließen als zuvor anerkannt – eine Realität, die oft von Historikern der viktorianischen Ära verborgen wurde, die ihre eigenen Werte rückwirkend projizierten.
Diese Individuen standen an der Schnittstelle von Macht und persönlicher Wahrheit und nutzten das eine, um das andere auszudrücken. Sie wurden bis zu einem gewissen Grad durch ihren Rang geschützt, doch letztendlich stellte ihre Queerness sie in Konflikt mit den erwarteten Normen, was Opfer erforderte (sei es Nzinga's Einsamkeit, Christina's Krone oder Ludwig Viktor's Exil). Ihre unauslöschlichen Spuren in der Geschichte fordern das Missverständnis heraus, dass Diskussionen über Geschlechtervielfalt und transgender Königtum rein moderne Phänomene sind. Tatsächlich zeigt die Geschichte, dass es immer dann, wenn es starre Regeln für Geschlecht und Sexualität gab, auch außergewöhnliche Royals gab, die sie verbogen oder brachen – und manchmal ein Vermächtnis gerade wegen ihres Widerstands schufen.
Kolonialismus und Christentum: Auslöschung queerer königlicher Vermächtnisse
Mit dem Eintritt in das Zeitalter der europäischen Expansion und des globalen Imperiums (18.–20. Jahrhundert) wurde das lebendige, wenn auch zarte Geflecht der LGBTQ+ königlichen Geschichte stießen auf Kräfte, die versuchten, es zu entwirren. Kolonialismus und die Verbreitung abrahamitischer Religionen (insbesondere in ihren konservativeren Auslegungen) veränderten die Einstellungen gegenüber gleichgeschlechtlichen Beziehungen und nichtkonformen Geschlechterrollen weltweit dramatisch.
Was in vielen vorkolonialen Kulturen relativ akzeptiert oder integriert war, wurde unter kolonialer Herrschaft oft verurteilt und kriminalisiert. Europäische Kolonialverwalter und Missionare legten ihre rechtlichen und moralischen Codes den Kolonien in Afrika, Asien und Amerika auf – meist mit der Überzeugung, dass indigene Praktiken gleichgeschlechtlicher Liebe oder Geschlechterfluidität “heidnisch” oder “barbarisch” seien und ausgemerzt werden müssten. Das Ergebnis war eine systematische Auslöschung oder Reinigung queerer Geschichten, einschließlich königlicher, in kolonisierten Gesellschaften.
Auch in Europa brachte das viktorianische Zeitalter einen Frost in die Art und Weise, wie Geschichte aufgezeichnet wurde: Historiker im 19. Jahrhundert weißen oder verharmlosten häufig die Queerness vergangener Monarchen, um die Erzählungen mit den vorherrschenden Moralvorstellungen in Einklang zu bringen. Diese Periode stellt eine der dunkelsten für LGBTQ+-Menschen (königlich oder anderweitig) dar, da sich rechtliche Strukturen und soziale Einstellungen gegen sie verhärteten.
Export von Anti-Sodomie-Gesetzen
Das Britische Empire exportierte seine viktorianischen Anti-Sodomie-Gesetze in jedes Territorium, das es kontrollierte – von Indien über die Karibik bis nach Afrika südlich der Sahara. Diese Gesetze (wie Abschnitt 377 des indischen Strafgesetzbuches, das 1860 verfasst wurde) kriminalisierten “fleischlichen Verkehr gegen die Ordnung der Natur,” ein direkter Angriff auf gleichgeschlechtliche Beziehungen. Entscheidend ist, dass sie eine Vielfalt vorkolonialer Einstellungen verdrängten.
In Indien und Südasien weisen historische Belege und persische Chroniken darauf hin, dass einige muslimische Nawabs und hinduistische Prinzen männliche Liebhaber hielten oder transgeschlechtliche Höflinge hatten (wie die Hijra-Gemeinschaften, die oft an königlichen Höfen dienten). Die Briten, die von solchen Praktiken schockiert waren, setzten ihren Rechtskodex und ihre prüden viktorianischen Werte durch, wodurch diese Praktiken in den Untergrund getrieben wurden.
Das britische Kolonialestablishment nutzte oft Anschuldigungen von “unnatürlichem Laster”, um lokale Herrscher zu diskreditieren, die sie kontrollieren oder entfernen wollten. So wurde Homophobie zu einem Werkzeug des Imperiums. In Fürsten-Indien gab es Fälle, in denen britische Residentenberater Akten über das Privatleben indischer Prinzen führten, die als Druckmittel eingesetzt werden konnten. Ein Muster wiederholt sich in vielen anderen kolonialen Kontexten. Das britische Kolonialrecht hat ein toxisches Erbe in Bezug auf LGBTQ+-Rechte weltweit hinterlassen.
Ein tragisches Ergebnis dieser Kräfte war die persönliche Qual derer, die zwischen den Welten gefangen waren. Betrachten Sie Ali I. vom Sultanat Johor in Malaya oder Maharaja Raghuji Bhonsle II. von Nagpur in Indien – dies sind weniger bekannte Herrscher, die angeblich gleichgeschlechtliche Beziehungen hatten, die unter britischer Beobachtung zu Skandalen führten und zu ihrer politischen Schwächung oder Absetzung führten.
In vielen Fällen verschleierten oder zensierten Kolonialbehörden absichtlich Aufzeichnungen über LGBTQ+-Verhalten unter lokalen Royals, entweder aus Verlegenheit oder um das Image zu fördern, die Einheimischen von „Unmoral“ zu retten. Normen, die im Christentum und viktorianischer Prüderie verwurzelt sind, marginalisierten zunehmend queere Identitäten in kolonisierten Ländern.
König Mwanga II von Buganda
Ein krasses Beispiel für den kolonialen Einfluss auf ein queeres königliches Erbe ist die Geschichte von König Mwanga II von Buganda (ein Königreich im heutigen Uganda). Mwanga II, der 1884 an die Macht kam, war ein junger König zu einer Zeit, als der europäische (insbesondere britische) Einfluss in Ostafrika zunahm. Es ist dokumentiert, dass er männliche Partner unter seinen Höflingen und Pagen hatte – tatsächlich war er nach heutigem Verständnis offen schwul oder bisexuell.
Im traditionellen Buganda-Kontext war Polygamie (einschließlich Ehefrauen für den König) normal, es war jedoch nicht ungewöhnlich, dass ein König auch sexuelle Beziehungen zu Männern suchte. Dies hatte zuvor keinen offenen Aufstand verursacht. Doch während Mwanga's Herrschaft hatten christliche Missionare (katholische und anglikanische) viele seiner Untertanen, einschließlich einiger Pagen, bekehrt.
Als diese neu frommen christlichen Pagen begannen, die sexuellen Avancen des Königs unter Berufung auf christliche Lehren gegen Sodomie zu verweigern, sah Mwanga dies als Rebellion gegen seine Autorität, angestiftet durch fremde Religion. Der Konflikt eskalierte: 1886 befahl Mwanga die Hinrichtung einer Gruppe junger Pagen und Diener – viele von ihnen waren kürzlich konvertierte Christen – weil sie ihm die Stirn boten.
Diese Opfer wurden als die Uganda-Märtyrer bekannt (heute verehrte Heilige in der katholischen und anglikanischen Kirche), und ihr Tod wurde von Missionaren als heldenhafter Widerstand gegen einen verdorbenen, homosexuellen König dargestellt. Aus Mwanga's Sicht behauptete er königliche Vorrechte und wehrte sich gegen ein eindringendes Glaubensbekenntnis, das seine traditionellen Rechte (einschließlich sexueller) als König untergrub.
Die Briten, die bereits die Kontrolle über Buganda anstrebten, nutzten diese Unruhen zu ihrem Vorteil. Sie stellten Mwanga als grausamen, unmoralischen Tyrannen dar – und betonten seine Homosexualität als Beweis für seine Barbarei. Bis 1897 hatten sie ihn abgesetzt und ins Exil geschickt und eine indirekte Kolonialherrschaft etabliert. Mwanga II's Untergang war direkt mit dem Konflikt zwischen indigener Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Beziehungen und importierter christlicher Moral verbunden.
Kolonialarchive stellten die Erzählung lange als „gute Christen“ gegen „bösen schwulen König“ dar und rechtfertigten so das Eingreifen der Imperialisten. Bis heute ringt die ugandische Politik mit diesem Erbe: Gegner der LGBTQ+-Rechte in Uganda behaupten häufig (und fälschlicherweise), Homosexualität sei ein fremder Import und ignorieren dabei den klaren historischen Fall, dass ein afrikanischer König des 19. Jahrhunderts offen queer war, bevor die Kolonialisten überhaupt eintrafen. In Wirklichkeit, wie eine wissenschaftliche Analyse hervorhebt, ist Mwangas Geschichte ein Beweis dafür, dass Homosexualität kein „unafrikanischer Import“ war – vielmehr war es die Homophobie.
Straightwashing in Europa
Britische Anti-Sodomie-Gesetze und strenge puritanische Moralvorstellungen beeinflussten nicht nur die Kolonisierten. Innerhalb Europas kam es im 19. Jahrhundert zu einem historiographischen Straightwashing. Viktorianische Historiker, die über Kaiser Hadrian oder König James I. schrieben, ließen oft ihre gleichgeschlechtlichen Beziehungen aus oder beschönigten sie. Während viktorianische Übersetzer griechischer Geschichte und Mythologie Geschichten 'säuberten' – Zeus und Ganymed als nur Freunde darstellten oder das Heilige Band von Theben (eine Armee männlicher Liebhaber) als „Kameraden“ bezeichneten.
In königlichen Biografien, wenn ein König einen bekannten männlichen Favoriten hatte, wurde dies möglicherweise als platonische Mentorschaft abgetan. So wurde das historische Protokoll selbst durch eine heteronormative Linse umgeschrieben, wodurch die LGBTQ+-Aspekte von Monarchen effektiv aus dem Verständnis der Öffentlichkeit gelöscht oder heruntergespielt wurden.
Erst im späten 20. Jahrhundert überprüften Akademiker viele Primärquellen erneut und sagten, Moment, da gibt es mehr zu dieser Geschichte. Zum Beispiel haben wir früher in diesem Artikel die Briefe von James I. an Buckingham besprochen; diese Briefe waren bekannt, aber frühere Generationen von Wissenschaftlern ignorierten sie oft oder entschuldigten sie als blumige Sprache der damaligen Zeit. Erst als sich die sozialen Einstellungen änderten, fühlten sich Historiker freier, offen anzuerkennen „Ja, James war sehr wahrscheinlich schwul oder bi“ und integrierten dies in das Mainstream-Geschichtsschreiben
Bis zum frühen 20. Jahrhundert, als die Kolonien unabhängig wurden, blieben viele der Anti-LGBT-Kolonialgesetze leider bestehen und wurden in die Rechtssysteme der neuen Nationen integriert. Die postkolonialen Führer, oft sozial konservativ, behielten diese Gesetze bei, sei es aus Trägheit oder dem Wunsch, sich mit religiösen Mehrheiten in Einklang zu bringen. Wie eine Analyse feststellt, „Fast die Hälfte der 71 Länder, die weiterhin private, einvernehmliche gleichgeschlechtliche Intimität kriminalisieren, sind ehemalige britische Kolonien“ – eine aufschlussreiche Statistik über die anhaltenden Auswirkungen des Kolonialismus.
Indien entkriminalisierte Homosexualität erst 2018, ein Gesetz, das direkt vom britischen Raj geerbt wurde. Ebenso setzen zahlreiche afrikanische Länder heute Kolonialzeit-Sodomiegesetze durch, als wären sie indigen (Uganda ist ein Paradebeispiel – seine aktuellen Anti-LGBTQ-Stimmungen spiegeln ironischerweise die importierten Einstellungen wider, die König Mwanga ins Exil brachten).
Man könnte argumentieren, dass die Kolonialzeit versuchte, eine nahezu globale Verdrängung der queeren Geschichte zu betreiben. Könige, die einst für ihre Schirmherrschaft oder Tapferkeit geehrt wurden, wurden nun (wenn überhaupt) mit einem Makel in Erinnerung behalten, oder ihre Queerness wurde aus der Erzählung entfernt, um der auferlegten moralischen Ordnung zu entsprechen.
Der Reichtum an, sagen wir, afrikanischen traditionellen Praktiken von Geschlechtervarianten oder asiatischen Hoftraditionen von männlichen Favoriten wurde gewaltsam durch ein starres Binärsystem und moralische Verurteilung ersetzt. So können wir die Kolonialzeit als Unterbrechung sehen – ein paar Jahrhunderte, in denen Intoleranz herrschte – anstatt als dauerhaften Zustand. Die Widerstandsfähigkeit der LGBTQ+-Gemeinschaft bedeutete, dass es selbst unter drakonischen Gesetzen noch Aristokraten und Könige gab, die authentische, aber vorsichtige Leben führten, oft leise unterstützt von denen um sie herum, die die Wahrheit kannten.
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als das britische Empire und andere Imperien verblassten und säkulare moderne Staaten entstanden, begann eine Neubewertung. Länder begannen allmählich, die kolonialen Gesetze abzubauen (zum Beispiel entkriminalisierte England selbst Homosexualität 1967, und viele ehemalige Kolonien haben dies erst kürzlich getan oder stehen noch davor). Diese rechtliche Auflockerung hat es Historikern und der Öffentlichkeit in diesen Ländern ermöglicht, historische queere Figuren neu zu untersuchen und manchmal zu rehabilitieren.
Im Wesentlichen versuchte die Kolonialzeit, die queere königliche Geschichte auszulöschen, konnte sie jedoch nicht vollständig eliminieren. Was überlebte – in Archiven, Folklore, Kunst und Wissenschaft – hilft modernen Gesellschaften nun zu verstehen, dass LGBTQ+-Identitäten keine „westliche Erfindung“ sind, sondern ein integraler Bestandteil ihres eigenen Erbes, das unterdrückt wurde.
Wenn wir uns der modernen Ära zuwenden, werden wir sehen, dass dieses Wiederaufleben des Verständnisses Hand in Hand geht mit aktuellen Königen und Aristokraten, die den Wandel annehmen, und mit Gesellschaften, die vergangene Ungerechtigkeiten anerkennen.
Moderne Renaissance: Offene Royals, sich ändernde Gesetze und neue Vermächtnisse
Das 20. und 21. Jahrhundert haben eine außergewöhnliche Transformation in der Sichtbarkeit und Akzeptanz von LGBTQ+-Individuen erlebt, und dieser Wandel hat sich, wenn auch allmählich, in die konservativen Welten der Monarchie und Aristokratie ausgedehnt. Die bloße Vorstellung eines „offen schwulen Prinzen“ oder einer gleichgeschlechtlichen königlichen Hochzeit, einst undenkbar, ist nun Teil der Realität – ein Zeichen dafür, wie weit die zeitgenössischen LGBTQ+-Rechtsbewegungen die öffentliche Meinung verändert haben.
Diese moderne Offenheit steht auf den Schultern all der historischen Figuren, die wir besprochen haben. Da restriktive Gesetze aufgehoben und soziale Einstellungen liberalisiert wurden (insbesondere seit dem späten 20. Jahrhundert), gibt es eine Art Heimkehr für queere Royals: Heutige Könige und Adelige outen sich und leben authentisch, während Medien und Wissenschaft endlich LGBTQ+-Themen in der königlichen Geschichte anerkennen.
 Lord Ivar Mountbatten
Lord Ivar Mountbatten
Ein Wendepunkt kam im späten 20. Jahrhundert, als Mitglieder europäischer Königshäuser begannen, sich öffentlich zu outen. Ein frühes Beispiel war die Familie von Lord Mountbatten von Burma – nicht der berühmte Earl Mountbatten aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, sondern sein weniger bekannter Verwandter Lord Ivar Mountbatten (geboren 1963). Lord Ivar, ein Cousin von Königin Elizabeth II., machte 2016 Schlagzeilen, als er bekannt gab, dass er schwul ist – und wurde damit das erste Mitglied der erweiterten britischen Königsfamilie, das sich öffentlich outete. Im folgenden Jahr kündigte er an, seinen Partner James Coyle zu heiraten.
Im Jahr 2018, mit dem Segen seiner Ex-Frau und Kinder (tatsächlich führte seine Ex-Frau ihn als Zeichen der Unterstützung zum Altar), hatten Ivar und James eine Hochzeit – die erste gleichgeschlechtliche Ehe in der britischen Königsfamilie. Dieses Ereignis war sinnbildlich für die neue Ära: Es wurde positiv in der Presse behandelt, in Gesellschaftsmagazinen gefeiert und sogar vom Buckingham Palace als private Angelegenheit des Glücks anerkannt.
Lord Ivar selbst kommentierte, dass er es „ziemlich erhebend“ fand, sich geoutet zu haben, obwohl er anfangs das Gefühl hatte, es sei “alarmierend”, als „der erste schwule Royal“ bezeichnet zu werden – eine Erinnerung daran, dass selbst Pioniere das Gewicht der Einzigartigkeit tragen.
Seine Ehe verlieh seinem Ehemann keinen Titel (die britische aristokratische Tradition gewährt derzeit gleichgeschlechtlichen Ehepartnern nicht automatisch Höflichkeitstitel, eine Ungleichheit, die wahrscheinlich mit der Zeit korrigiert wird), aber sie signalisierte, dass es kein Hindernis darstellt, schwul zu sein, um ein respektiertes Mitglied der Königsfamilie zu bleiben.
 Prinz Manvendra Singh Gohil
Prinz Manvendra Singh Gohil
In einem anderen Teil der Welt war ein noch bahnbrechenderer königlicher Vertreter ein Jahrzehnt zuvor aufgetaucht: Prinz Manvendra Singh Gohil des ehemaligen Fürstenstaates Rajpipla in Indien. Manvendra machte 2006 internationale Schlagzeilen, als er offen erklärte, dass er schwul ist – etwas, das für einen indischen Prinzen beispiellos war. Die Enthüllung war in Indien so schockierend (wo zu dieser Zeit Homosexualität noch unter dem von den Briten auferlegten Abschnitt 377 kriminalisiert war), dass seine eigene Familie ihn zunächst aus Verlegenheit verstoß. Aber Manvendra blieb standhaft.
Im Laufe der Zeit versöhnte er sich mit seinen Eltern und noch wichtiger, er verwandelte seinen persönlichen Kampf in Aktivismus. Er gründete die Lakshya Trust, die sich für HIV/AIDS-Aufklärung und LGBTQ+-Anliegen einsetzt, und wurde vielleicht Indiens sichtbarster LGBTQ+-Rechtskämpfer. 2013 heiratete er einen Amerikaner, was sein persönliches Glück festigte (obwohl diese Ehe damals in Indien nicht legal anerkannt wurde).
Manvendras mutige Sichtbarkeit – von Oprah Winfreys Talkshow bis hin zu internationalen Menschenrechtsforen – zeigte, wie königlicher Status genutzt werden könnte, um LGBTQ+-Akzeptanz zu fördern, selbst in sozial konservativen Umgebungen. Er öffnete buchstäblich seinen königlichen Palast, um als Zentrum für gefährdete LGBTQ+-Menschen zu dienen, die von ihren Familien verstoßen wurden.
Bis 2018, als Indiens Oberster Gerichtshof schließlich das Sodomiegesetz aufhob, wurde Prinz Manvendra weithin als Held gefeiert, der geholfen hatte, den Weg zu ebnen. Sein Weg, vom Ausgestoßenen zum gefeierten Aktivisten, spiegelt den breiteren Wandel der Einstellungen wider – er nutzte den Respekt, der der Königsfamilie in Indien immer noch entgegengebracht wird, um zu zeigen, dass Schwulsein mit Tradition und Ehre vereinbar ist. Tatsächlich schafft er eine neue Art von queerer königlicher Erbe, eines des Aktivismus und sozialen Wandels statt politischer Herrschaft.
 Luisa Isabel Álvarez de Toledo
Luisa Isabel Álvarez de Toledo
Eine weitere moderne Pionierin war eine spanische Aristokratin, bekannt als die „Rote Herzogin“. Luisa Isabel Álvarez de Toledo, 21. Herzogin von Medina Sidonia (1936–2008), war eine Grande von Spanien – Inhaberin eines der ältesten Adelstitel des Landes – und auch eine ausgesprochene linke Dissidentin während der Franco-Ära.
In ihrem Privatleben war Luisa Isabel in engen Kreisen offen lesbisch oder bisexuell. In einem letzten Akt der Auflehnung gegen die Konvention heiratete sie 2008 auf ihrem Sterbebett ihre langjährige Partnerin Liliana Dahlmann. Diese geheime standesamtliche Zeremonie, die nur wenige Stunden vor ihrem Tod stattfand, schockierte ihre entfremdeten Kinder und machte weltweit Schlagzeilen.
Jahrzehntelang war die Herzogin leise in lesbischen Aktivistengruppen engagiert, aber die konservative Gesellschaft Spaniens (besonders unter Franco) hatte sie davon abgehalten, vollständig offen zu leben. Bis 2008 hatte Spanien jedoch die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert – also nutzte die Herzogin die Gelegenheit, ihre Partnerin von über 20 Jahren legal zu heiraten und sicherzustellen, dass ihre Geliebte Erbin ihres Nachlasses und ihrer Archive würde. Es war, wie Zeitungen es nannten, „der letzte, trotzige Akt” eines sehr trotzigen Lebens.
Die Folgen – ein Rechtsstreit zwischen ihren Kindern und ihrer Witwe – waren chaotisch, aber in Bezug auf das Vermächtnis wurde die „Rote Herzogin“ zu einer Ikone für LGBTQ+-Rechte im Adel. Sie bewies, dass selbst ein siebzigjähriger Blaublüter Veränderungen annehmen konnte und dass Liebe über Abstammung triumphierte. Ihre Geschichte übte auch Druck auf die adeligen Kreise Spaniens aus, LGBTQ+-Mitglieder in ihrer Mitte anzuerkennen.
Königliche gleichgeschlechtliche Ehe
Die königlichen Familien selbst haben sich ebenfalls angepasst – einige langsam, andere in progressiven Sprüngen – an die sich ändernde rechtliche Landschaft bezüglich LGBTQ+-Rechten. Ein bemerkenswertes Beispiel für rechtliche Anpassung ereignete sich in den Niederlanden, einem Land, das oft an der Spitze der Gleichstellung steht.
Im Jahr 2001 waren die Niederlande das erste Land, das die gleichgeschlechtliche Ehe legalisierte. Doch dies warf eine theoretische Frage auf: Was wäre, wenn ein niederländischer Monarch oder Thronfolger jemanden des gleichen Geschlechts heiraten wollte? Würde das die Thronfolge oder die verfassungsmäßige Ordnung bedrohen? Jahrelang war es ein Thema spekulativer Diskussionen, bis es 2021 aufgrund eines Buches und einer öffentlichen Debatte zu einem realen Thema wurde.
Der niederländische Premierminister Mark Rutte unternahm den Schritt, die Haltung der Regierung öffentlich klarzustellen: die Kronprinzessin (Catharina-Amalia) oder jedes Mitglied der königlichen Familie kann eine Person jeden Geschlechts heiraten und nicht ihr Recht auf den Thron verlieren. In einem Brief an das Parlament schrieb Rutte, “Die Regierung ist der Meinung, dass der Thronfolger auch eine Person des gleichen Geschlechts heiraten kann” und erklärte ausdrücklich, dass die sexuelle Orientierung eines Königs oder einer Königin für die Königswürde keine Rolle spielen sollte.
Diese Ankündigung – im Wesentlichen „gleichgeschlechtliche Ehe ist für niederländische Monarchen möglich” – war ein historisches Novum. Es erkannte an, dass sich die Welt verändert hat: Ein zukünftiger niederländischer Monarch könnte einen gleichgeschlechtlichen Ehepartner haben, und die konstitutionelle Monarchie würde einfach fortbestehen. Es blieben praktische Fragen zu Kindern (da die Nachfolge in Monarchien traditionell biologische Nachkommen voraussetzt), aber der Premierminister merkte vernünftigerweise an, dass diese behandelt werden könnten, wenn sie auftreten.
Die Bedeutung dessen kann nicht genug betont werden: Es war das erste Mal, dass eine regierende Regierung ausdrücklich bestätigte, dass ein regierender Souverän in einer gleichgeschlechtlichen Ehe sein könnte, ohne abdanken zu müssen. Dies setzt einen Präzedenzfall, dem andere europäische Monarchien folgen könnten. Bereits jetzt wäre die öffentliche Meinung in vielen dieser Länder unterstützend – Umfragen im Vereinigten Königreich haben zum Beispiel gezeigt, dass die Menschen einen schwulen König oder eine schwule Königin akzeptieren würden. Und tatsächlich hat die britische Königsfamilie Gesten der Unterstützung gemacht; Prinz William, der Zweite in der Thronfolge, sagte 2019, dass es für ihn "absolut in Ordnung" wäre, wenn seine Kinder als schwul herauskämen, obwohl er sich Sorgen über den Druck machte, dem sie ausgesetzt wären.
LGBTQ+-Anwaltschaft und Repräsentation
Jenseits des persönlichen Lebens haben moderne Royals LGBTQ+-Anwaltschaftsrollen übernommen. Zum Beispiel haben Mitglieder der britischen Königsfamilie – die möglicherweise nicht selbst LGBTQ+ sind – öffentlich die Gleichstellung gefördert. Die verstorbene Prinzessin Diana hat in den 1980er Jahren HIV/AIDS-Patienten berührt und dazu beigetragen, das damals als "Schwulenkrankheit" angesehene Stigma zu beseitigen. In jüngerer Zeit haben Prinz Harry und Meghan Markle starke Unterstützung für LGBTQ+-Rechte geäußert, und andere jüngere Royals sind ihrem Beispiel gefolgt, indem sie LGBTQ+-Wohltätigkeitsorganisationen unterstützen.
In Skandinavien haben Kronprinzessin Mary von Dänemark und Kronprinzessin Victoria von Schweden an LGBTQ+-Veranstaltungen teilgenommen oder sich gegen Diskriminierung ausgesprochen und setzen damit inklusive Beispiele in ihren Ländern. Diese Aktionen von heterosexuellen Verbündeten in königlichen Rängen veranschaulichen, wie Königtum und LGBTQ+-Rechte in der öffentlichen Vorstellung nicht mehr im Widerspruch stehen, sondern zunehmend im Einklang sind. In vielerlei Hinsicht haben die königlichen Familien (oft als Bastionen der Tradition angesehen) erkannt, dass die Unterstützung von LGBTQ+-Bürgern Teil des Bestrebens ist, in modernen demokratischen Gesellschaften relevant und geliebt zu bleiben.
Wir sehen auch queere Repräsentation in Medien und Popkultur, die königliche Geschichten einem neuen Publikum näherbringt. Der Film The Favourite (2018) stellte die Beziehungen von Königin Anne zu Sarah Churchill und Abigail Masham in den Vordergrund, gewann Preise und veranlasste die Zuschauer, die wahre Geschichte zu lernen. Fernsehserien wie Versailles stellten unerschrocken Philippe d’Orléans’ Cross-Dressing und männlichen Liebhaber dar und führten seine Geschichte als Teil des Mainstream-Historien-Dramas erneut ein . Dokumentationen und Bücher beleuchten erneut Persönlichkeiten wie Friedrich den Großen von Preußen (allgemein als homosexuell angesehen) oder Ludwig II. von Bayern und machen deren Privatleben zu einem Teil ihrer Erzählung anstelle von Fußnoten. Zum Beispiel bemerkte ein Artikel in Psychology Today, dass "die meisten Gelehrten heute zustimmen, dass Ludwig fast sicherlich homosexuell war" – eine Aussage, die vor einigen Jahrzehnten abgeschwächt oder weggelassen worden wäre, jetzt aber offen gedruckt wird. Selbst Geschichtsbücher für Kinder beginnen, diese Fakten zu erwähnen, was auf eine Normalisierung der queeren Geschichte hinweist.
Während wir diesen fortwährenden Wandel beobachten, gibt es ein eindringliches Gefühl der Verbindung mit der Vergangenheit. Als Lord Ivar Mountbatten Ringe mit seinem Ehemann tauschte, könnten irgendwo im Äther die Geister von Edward II. oder James I. gelächelt haben, als ob sie einen Wunsch erfüllt sahen, den sie zu ihrer Zeit nie hätten erfüllen können. Wenn Prinz Manvendra gefährdete LGBTQ+-Jugendliche in seinem Palast beherbergt, nickt vielleicht Nzinga's Geist zustimmend zu einem Herrscher, der die Marginalisierten schützt. Geschichte ist niemals wirklich vergangen; sie lebt weiter in der Art und Weise, wie wir unsere Gesellschaft jetzt gestalten. Indem wir die Geschichten der LGBTQ+-Royals von einst zurückerobern und die LGBTQ+-Royals von heute feiern, stellen wir sicher, dass der Regenbogenfaden, der sich durch die königliche Geschichte zieht, nicht nur sichtbar, sondern hell erleuchtet ist.
Die sich wandelnde Regenbogenkrone
Die Reise durch die Annalen der queeren Königlichkeit – vom Schnittärmel des Kaisers Ai, über mittelalterliche Könige, die alles für die Liebe riskierten, bis hin zu modernen Prinzen, die sich bei Pride engagieren – offenbart eine Erzählung, die so reich und komplex ist wie jede andere in der Geschichte. Zu lange waren diese Geschichten Fußnoten oder Flüstern, aber heute erklingen sie offen und fordern uns auf, das, was wir über Monarchie zu wissen glaubten, neu zu überdenken. LGBTQ+-Monarchen und Adlige waren immer da, prägten die Kultur, beeinflussten die Politik oder lebten einfach ihre persönlichen Wahrheiten hinter Palasttüren. Ihre Erfahrungen, einst verborgen in kodifizierten Chroniken oder angedeutet in Briefen, treten nun als lebendige Teile der menschlichen Geschichte ans Licht.
Diese Wiederbelebung geht nicht darum, modernen Labels historische Figuren aufzuzwingen, sondern um Ehrlichkeit und Vollständigkeit. Wir haben gesehen, wie die gesellschaftlichen Einstellungen gegenüber LGBTQ+-Identitäten zwischen Akzeptanz und Verfolgung geschwankt haben und wie diese Schwankungen individuelle Leben beeinflussten: Das offene Geheimnis einer Generation wurde zum Skandal der nächsten Generation und dann wieder zu einem stolzen Symbol. Der Einfluss von Religion und Kolonialismus versuchte, die Erzählung einzuengen, konnte sie letztlich aber nicht auslöschen. Jetzt, da sich Gesetze ändern und sich die Gedanken öffnen, gibt es ein Gefühl der Wiederherstellung – den Königinnen, Königen und Adligen ihre volle Identität im Protokoll zurückzugeben, ungefiltert durch vergangene Vorurteile.
Die modernen Entwicklungen – rechtliche Reformen, die es einer Kronprinzessin erlauben, eine Frau zu heiraten, königliche Familien, die gleichgeschlechtliche Ehen feiern, Prinzen und Herzöge, die auf Magazincovern ihr Coming-out haben – würden viele aus früheren Epochen in Erstaunen versetzen. Und doch würden sie vielleicht auch ein Gefühl der Genugtuung oder Erleichterung empfinden. Zum ersten Mal könnte ein regierender britischer Monarch denkbarerweise homosexuell sein und nicht gezwungen werden, zwischen der Krone und der Liebe zu wählen. Ein europäischer Herzog kann bei einem Staatsanlass seinen Ehemann ohne Scham vorstellen. Dies sind stille Revolutionen innerhalb großer Traditionen.
Die Annalen der Geschichte sind nicht nur Geschichten von Schlachten und Eroberungen, sondern auch von vielfältiger Liebe und verborgenen Romanzen. Wir müssen nur auf diese weitläufigen Paläste von einst blicken, wo Flüstern verbotener Liebe oft durch die ehrwürdigen Hallen wehte. Unter diesen Geschichten von Tapferkeit und Ruhm findet man die verflochtene Saga von schwuler Königlichkeit. Hier entfalten sich die Vermächtnisse von LGBTQ+ Monarchen und queerem Adel, königlich, aber oft unter Schichten der Geschichte verborgen.
Stellen Sie sich Herrscher vor, die hinter den schweren Vorhängen der Souveränität ihre gleichgeschlechtlichen Partner mit diskreter, aber nicht weniger leidenschaftlicher Liebe schätzten. In diesem Tableau sprechen die Lebensgeschichten von homosexuellen Königen und Königinnen von einer Zeit, in der die Erzählungen von gleichgeschlechtlichen Herrschern, königlichen LGBTQ+ Figuren und historischen schwulen Anführern im Geheimen gehüllt waren, aber zutiefst menschlich in ihrem Kern. Das sich entfaltende Tapisserie von LGBTQ Königlichkeit erzählt eine Geschichte nicht nur von Kronen und Thronen, sondern von Herzen, die sich nicht von den Konventionen ihrer Zeit einengen ließen.
Quellen:
Prager, Sarah. “In Han Dynasty China, Bisexuality Was the Norm.” JSTOR.
Liverpool Museums. “Antinous and Hadrian.” National Museums Liverpool.
“Edward II of England” and English Heritage. “Piers Gaveston, Hugh Despenser und der Untergang von Edward II.” English Heritage.
Historische Königliche Paläste. “LGBT+ Königliche Geschichten.” HRP.org.uk.
Wikipedia. “Al-Hakam II” (Abschnitte über mögliche Homosexualität und Subh).
Norton, Rictor (Hrsg.). Mein Lieber Junge: Schwule Liebesbriefe durch die Jahrhunderte – Briefe von König James I. an den Herzog von Buckingham.
Wikipedia. “Sexualität von James VI und I”.
Wikipedia. “Les Mignons” – über die Favoriten von Heinrich III. von Frankreich.
The Gay & Lesbian Review. “König Henri III und seine Mignons” (Analyse von Heinrichs Ruf).
Tatler Magazin. “Königlicher Stolz: Könige im Laufe der Geschichte, die LGBT waren” von Isaac Bickerstaff, 2024.
Tatler. Königlicher Stolz: Könige im Laufe der Geschichte, die LGBT waren.
MambaOnline. “Königlich queer: 6 queere Könige, die Sie wahrscheinlich nicht kannten,” 2023.
Africa Is a Country. “Sechs LGBTQ+ Figuren aus der afrikanischen Geschichte,” 2020.
O’Mahoney, Joseph. „Wie das koloniale Erbe Großbritanniens die LGBT-Politik weltweit beeinflusst.” The Conversation, 17. Mai 2018.
Ferguson, Christopher. „Wie verbotene Liebe der Oper nützte – War Bayerns verrückter König in Richard Wagner verliebt?“ Psychology Today, 27. Sep 2019.
Reuters. „Liebe ist Liebe: Gleichgeschlechtliche Ehe möglich für niederländischen Monarchen,“ 2021.
Telegraph (UK). „Rote Herzogin heiratete lesbische Geliebte, um Kinder zu brüskieren,“ 2008.
Business Insider. „6 LGBTQ+ Royals, die Sie wahrscheinlich nicht kannten,“ 2023
History Today J.S. Hamilton, „Ménage à Roi: Edward II und Piers Gaveston“